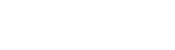Von Volker Seifert
Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörten Bücher von Autoren wie Hermann Löns, Oskar von Riesenthal, Ludwig Benindikt von Cramer-Klett oder Hans Friedrich Blunck in jede gut sortierte Bibliothek von Förstern, Jägern und naturverbundenen Lesern. Jagdliche Erzählungen, forstliche Abhandlungen und naturkundliche Beobachtungen waren nicht nur Fachlektüre, sondern auch Teil eines größeren kulturellen Kanons. Heute verstauben sie in Antiquariaten, werden in Bibliotheken ausgesondert oder finden höchstens als dekoratives Beiwerk in Landgasthöfen Platz.
Der Rückgang hat mehrere Ursachen. Zum einen hat sich die Lebenswelt der Leser verändert: Die enge Verbindung zur Natur, die für frühere Generationen selbstverständlich war, ist in einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft seltener geworden. Die jagdliche Praxis ist nicht mehr kollektiver Erfahrungsraum, sondern ein spezialisiertes Hobby mit kleinem Kreis. Zum anderen haben sich literarische Strömungen verschoben. Der naturalistische Blick, der in langsamen Beobachtungen, jahreszeitlichen Rhythmen und jagdlichen Ritualen schwelgte, wirkt in einer beschleunigten, digitalisierten Welt für viele fremd oder gar antiquiert. Selbst unter Jägern sind die einstigen Klassiker kaum noch bekannt; neue Generationen wachsen mit Apps, YouTube-Videos und jagdlichen Kurzformaten auf, nicht mit Erzählungen, die Geduld und innere Bilder verlangen. Auch das moralische Klima hat sich gewandelt: Die Jagd wird heute oft unter ökologischen, ethischen und emotionalen Gesichtspunkten kritisch gesehen – eine Distanz, die es erschwert, mit den Heldenfiguren und Idealen alter Jagdprosa warm zu werden.
Doch mit dem Verschwinden dieser Literatur geht mehr verloren als nur ein Genre. Die jagdlichen und forstlichen Klassiker sind Zeitdokumente. Sie erzählen vom Wandel der Landschaften, von Flora und Fauna, wie sie in den jeweiligen Jahrzehnten tatsächlich waren – Beobachtungen, die oft detailreicher und genauer sind als viele heutige Berichte. Sie bewahren sprachliche Bilder, die das Verhältnis zwischen Mensch und Natur nicht romantisieren, sondern aus gelebter Erfahrung gestalten. Ihre Seiten sind von Jahreszeiten durchzogen, von Geräuschen, Gerüchen, Lichtstimmungen, die einen Sinn für Kontinuität und Verwurzelung vermitteln.
Umso dankenswerter ist es, dass es noch Autoren wie Dieter Stahmann, Gert G. von Harling, Florian Asche oder Bertram Graf von Quadt gibt, die sich nicht entmutigen lassen – und mit neuen Büchern in dieser Tradition beweisen, dass jagdliche Literatur mehr sein kann als Folklore. Sie schreiben gegen das Vergessen, für die Erinnerung – und für eine Sprache, die noch weiß, wie Wald klingt. Ebenso erfreulich ist, dass es immer noch Verlage gibt, die die Klassiker als Reprints auf dem Markt halten – wohl wissend, dass der wirtschaftliche Erfolg überschaubar bleibt.
In einer Zeit, in der der Mensch – und leider auch der jagdliche Nachwuchs – Gefahr läuft, die Natur nur noch als Freizeitkulisse zu begreifen, könnten diese Werke eine Brücke schlagen: Sie zeigen, dass Landschaft nicht bloß Bühne, sondern Lebensraum ist – für Tiere, Pflanzen und für uns selbst. Das Wiederentdecken dieser Literatur wäre nicht nostalgische Flucht, sondern eine Rückbesinnung auf eine Wahrnehmungsschärfe, die wir im digitalen Rauschen dringend gebrauchen könnten.