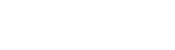Von Dr. Florian Asche
Mein Smartphone brummt und spuckt eine Kurznachricht aus. Zunächst öffne ich ein Foto von einem leeren Streckenplatz mit abgebrannten Schwedenfeuern. Nur am Rand liegen zwei Flecken mit Haaren. Dann kommt der deprimierende Text von einer fast wildfreien Drückjagd irgendwo in Norddeutschland. „Heute waren wir im Forstamt Wildex. Mit 50 Schützen und 20 Hunden lagen ein Kitz und einen Fuchs.“ Trauriger Smiley.
Wieder brummt es. „Bei Kleckersdorf war Drückjagd und es lag nicht eine einzige Sau auf der Strecke! Was war hier früher los?! Sic transit gloria mundi!“ Strebersmiley mit Brille.
Und wieder: „In Kleinmiesnitz haben die Beständer schon gar kein Damwild mehr freigegeben. Es geht bergab mit unserem Land.“ Wutsmiley.
Haben Sie in diesem Jahr auch derartige Nachrichten erhalten? Tatsächlich scheint die Realität an unserer jagdlichen Haustür zu klopfen. Nach vielen Jahren der beschwörenden Mahnungen unserer Politik, nun endlich die Schalenwildbestände zu reduzieren, deuten sich – zumindest gefühlt – erste „Erfolge“ an. Nach absoluten Spitzenergebnissen der vergangenen Jahre brechen die Strecken ein, falls man den jagdlichen Buschtrommeln glauben darf.
Klopfen wir uns nun gegenseitig auf die Schultern, nicken uns zu und stimmen das Loblied in eigener Sache an? Nein, das passt nicht zu uns Deutschen. Wir haben immer vor irgendetwas Angst. Eben fürchteten wir uns noch vor zu hohen Wildschäden und vor der ASP. Das war die Stunde der Forst- und Agrarlobby. Mit immer schrilleren Tönen wurde von ihr der „klimaresiliente Wald“ und die „zukunftsfähige Landwirtschaft“ gefordert. Zur Umsetzung dieser übergeordneten Ziele durfte man Waidgerechtigkeit und Fairness unterordnen. Die Jagdzeiten wurden verlängert und die Nachtzieltechnik legalisiert. Wer vorgestern noch ein jagdlicher Schweinehund war, der konnte sich nun als Held der Arbeit gegen die Wildschwemme fühlen. Und tatsächlich dürfte vor allem die Nachtzieltechnik und nicht canis lupus der Grund für die einbrechenden Strecken sein. Eine Sau, die im Neumond am Maisacker bleibt, liegt nun einmal nicht auf dem Streckenplatz der Herbstjagd. Es gibt also mehr zweibeinige als vierbeinige Wölfe und sie sind sehr, sehr erfolgreich.
Da sollten wir doch zufrieden mit dem Erreichten sein. Wir sollten und wollten die Bestände absenken und wir haben es getan. Doch wir sind nicht glücklich damit. Mitteltöne gibt es eben selten im deutschen Natur-Orchester.
Für die einen gibt es nur Trophäengeier und Rekordschießer, Egoisten, denen nur an Maßen und Zahlen liegt. Die anderen sehen nur die Wildfeinde und Wolfsfreunde, die möglichst alles Schalenwild ausrotten wollen, um ihre schräge Ideologie umzusetzen.
Am Ende sind beide Extreme natürlich völliger Unsinn. Wir werden das erkennen, wenn wir mit kühler Vernunft die Jahresstrecke 2022/23 auswerten. Unterstellen wir jetzt einmal, dass sie sich tatsächlich erheblich verringern wird, verglichen mit den Ergebnissen der zurückliegenden Jahre.
Beginnen wir mit dem Schwarzwild. 2019/2020 lagen deutschlandweit 880.000 Sauen auf der Strecke. Jetzt sehen wir einmal völlig schwarz und glauben, sie würde sich halbieren. Wären wir dann am Ende? Nein, wir lägen lediglich bei einem Normalmaß der Zeit um die Jahrtausendwende. Wäre das eine so schreckliche Katastrophe? Zwischen 1990 und 2000 pendelte die Schwarzwildstrecke zwischen 250.000 und 350.000 Sauen. Wollen wir behaupten, dass unser jagdliches Erleben damals trist und inhaltlos war?
Nicht viel anders liegt es beim Damwild. Würden wir die Strecken der vergangenen drei Jahre halbieren, dann befänden wir uns auf dem Niveau Anfang der 90iger Jahre. Wir waren doch damals keine jagdlichen Nichtraucher. Auch das Rehwild lieferte vor 40 Jahren eine gut halb so große Strecke wie heutzutage. Damals brachten wir 700.000 Stück nach Hause, heute sind es über 1.300.000. Und auch das Rotwild hat sich innerhalb der vergangenen 50 Jahre annähernd verdoppelt.
Aus dem Gefühl des Weniger müssen wir deshalb nicht zwangsläufig den Weltuntergang ableiten. Doch genau das tun wir mit dem schrillen Kreischen, das Ende der Jagd stehe vor der Tür.
Im Deutschen Reich des Jahres 1937/38 (und das war etwas größer als heutzutage) schossen die Jäger 36.448 Sauen. Allein im winzigen Hessen wird heutzutage das Doppelte erlegt. Unser Leben und unsere Jagd sind eben nicht nur Statistik. Deshalb sollten wir nicht gleich den Weltuntergang erwarten, wenn die Veränderungen der letzten Jahre die Strecken senken. Das Wieviel ist noch kein Grund, sich das Hirn zu zermartern.
Worüber wir uns allerdings mehr und mehr Gedanken machen sollten, dass ist die Art und Weise, wie wir unsere Jahresstrecken zusammenbringen, also über die Qualität unserer Jagd. Ist ein Reh mit Schuss durch das Kreuz ein Erfolg im Kampf für den „klimaresilienten Wald“? wirklich stolz sein? Oder ist es nur ein schweißverkrusteter Klumpen auf der Strecke?
Ist der 10-Kilo Frischling mit Streifen noch eine jagdliche Heldentat im Sinne der ASP-Bekämpfung? Und wie stolz ist man auf einen nachtzielerlegten Damknieper, den man zur Schadensabwehrsau umtauft?
Die Zahlen allein machen es nicht. Wir brauchen uns nicht einzubilden, die riesigen Strecken der zurückliegenden Jahrzehnte hätten sich nicht auf unser jagdliches Wertgefüge ausgewirkt. Tatsächlich haben sie das Wild und die Jagd völlig entwertet. Das sieht man nicht nur an den katastrophalen Wildbretpreisen der letzten Zeit, sondern man erfährt es aus den Geschichten der Schweißhundeführer. Diese Idealisten haben ein besonders feines Gespür, wenn es um den Umgang der Jäger mit der Natur geht. Es lohnt sich, ihnen zuzuhören:
- „In Dummstorf war Drückjagd. Bei 72 Schuss lagen 8 Sauen. Ich hatte zwei Anschüsse zu kontrollieren.“
- „Am 2. Mai ruft mich ein Jungjäger an. Er habe im letzten Büchsenlicht (seiner Nachtzieltechnik) auf einen Rotspießer geschossen. Es lag ein Kolbenhirsch vom 12. Kopf.“
- „Am 21. April meldet ein Jungjäger eine Nachsuche auf ein Schmalreh. Nach dreißig Schritten stehe ich an der Ricke. Die Kugel ist weidwund direkt durch das Kitz in der Tracht gegangen. Natürlich wieder Nachtzieltechnik.“
- „Mit dem Schützen stehe ich an der führenden Bache mit Weidwundschuss. Einen der Frischlinge, die direkt am Stück standen, habe ich noch bekommen. Da sagt der Kerl zu mir: Na ja, die machen wenigstens keinen Schaden mehr.“
Diese Verrohung im Umgang mit dem Wild ist das Ergebnis einer schlechten jagdethischen Ausbildung in Verbindung mit einer Vermassung der Wildbestände.
Es war Ortega Y Gasset, der meinte, dass zur echten Jagd auch eine gewisse Seltenheit des Wildes gehört, denn nur sie bringt die Mühe hervor, die der Beute ihren Wert verleiht. Vor einigen Jahren war ich in einem Spitzenrevier zur Schauflerbrunft eingeladen. Mein reizender Jagdführer und ich saßen an einer ausgedehnten Wildwiese. Es war nachmittags gegen fünf und ich erkannte aus dem Weidelgras einzelne Schaufeln herausragen. Das waren die Hirsche, die in der Sonne dösten. Schließlich blickte der Reviervater immer häufiger auf seine Uhr. „Es müsste jetzt langsam losgehen.“ Da wurde schon der erste Schaufler hoch, dann der nächste und nach einer halben Stunde saß ich mitten in einem brodelnden Kessel von schnurchelnden Damhirschen. „Suchen Sie sich einen aus“, war die freundliche Ansage des Profis. Als ich dann am erlegten Schaufler stand, war ich doch etwas ratlos. War das nicht Einkaufen mit Waffe?
Jagd ist die Wanderung auf einem kritischen Pfad. Und so wie es eine Ökonomie der Waren gibt, so führt ein Überangebot an Wild nahezu zwangsläufig zu einer Entwertung der damit verbundenen Jagderlebnisse. Schließlich gibt es ja auch eine Ökonomie der Liebe. Wer sich uns zu sehr an den Hals wirft, setzt den eigenen Wert herunter. Sich rar machen, das ist auch eine Kunst.
Nun, wir machen das Wild gerade rar. Und darin liegt vielleicht auch unser Glück. Vielleicht werden wir uns dann wieder über einen Knopfbock freuen oder über eine alte Ricke, einen Fuchs oder eine Ente. Im letzten Jahr war ich auf einer kleinen Stocherjagd in Friesland. Am Ende des Tages lag ein Dutzend Hasen auf der Strecke und ein paar Menschen, die für wenige Stunden dem Alltag entkommen waren, lachten sich breit an. „Dat woar ganz gaut, hüüd…“
Ein paar Tage zuvor hatte ich noch an einem Platz gestanden, auf dem zwanzig Sauen lagen. Der Jagdherr war traurig. „So ein Mist. Letztes Jahr waren es dreißig.“
So verändern sich nicht nur Zahlen, sondern Wertschätzung und Lebensglück. „Die sich um einen Rehbock eine Welt bauen.“ So nannte Heinrich von Gagern die echte Jagd, die nicht Zahlen gilt, sondern Erlebnissen. Wenn wir weiterhin so auf Normalmaß schrumpfen, dann werden wir auch wieder auf diesem Weg wandern. Es hat alles sein Gutes.
Erstveröffentlichung: Krautjunker.com vom 21.01.2023