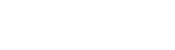Von Volker Seifert
Ludwig Wittgenstein, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat sich mit der Frage nach der Natur nicht in derselben Weise beschäftigt wie Philosophen wie Heidegger oder Schelling. Doch seine Philosophie, insbesondere in den beiden Hauptwerken „Tractatus Logico-Philosophicus“ (1921) und „Philosophische Untersuchungen“ (1953), bietet interessante Perspektiven auf den Begriff der „Natur“ und auf den menschlichen Umgang mit der Welt. Wittgenstein konzentrierte sich eher auf die sprachliche Bedeutung und die Art und Weise, wie der Mensch die Welt durch Sprache und Handlungen begreift. Auch wenn Wittgenstein kein explizites Werk über die Natur geschrieben hat, können wir seinen Naturbegriff durch seine philosophische Methodologie und die Analysen von Sprache und Bedeutung ableiten.
Die Jagd als eine spezifische menschliche Aktivität bietet eine interessante Anwendung von Wittgensteins Denken, da sie in verschiedenen Kontexten mit Sprache, Bedeutung, Handlungen und „Spielen“ verbunden ist. In dieser Abhandlung soll Wittgensteins Naturbegriff im Rahmen seiner philosophischen Arbeit untersucht werden, und es wird auf seine Anwendung auf die Jagd als eine Handlung, die in verschiedenen „Spielen“ und Lebensformen eingebettet ist, eingegangen.
1. Wittgensteins Naturbegriff und die Sprache
In Wittgensteins Denken gibt es keinen expliziten „Naturbegriff“, der in der klassischen Weise philosophisch formuliert wird. Stattdessen wird die Natur, wie alles, was wir als Welt erfahren, durch die Sprache verstanden. Wittgenstein beschäftigte sich in seinen späteren Arbeiten insbesondere mit der Bedeutung von Sprache und mit der Art und Weise, wie der Mensch Bedeutung erzeugt und in verschiedenen Kontexten interpretiert. Seine Philosophie konzentriert sich darauf, wie wir die Welt durch „Sprachspiele“ begreifen, und dabei spielt auch der Begriff der Natur eine Rolle, insofern er durch unsere sprachlichen Praktiken und Handlungen vermittelt wird.
1.1 Sprachspiele und Bedeutung
In den „Philosophischen Untersuchungen“ führt Wittgenstein das Konzept der „Sprachspiele“ ein, um die unterschiedlichen Weisen zu beschreiben, in denen Menschen Sprache verwenden, um sich auf die Welt zu beziehen. Sprachspiele sind unbestimmte, kontextabhängige Praktiken, die in sozialen Interaktionen und Handlungen eingebettet sind. Jedes Spiel hat eigene Regeln, die festlegen, wie Begriffe verwendet werden und was sie bedeuten.
In diesem Zusammenhang kann die „Natur“ nicht als eine feste, objektive Entität angesehen werden, die unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung existiert. Vielmehr ist die Natur das, was wir durch unsere Sprachspiele und durch die Kategorien, die wir in unserer Lebensform verwenden, begreifen. Der Begriff der Natur ist also im Wittgenstein'schen Sinne nicht eine feste Größe, sondern ein produktives Konzept, das durch den Gebrauch in verschiedenen sozialen und kulturellen Kontexten seine Bedeutung erhält.
1.2 Die Natur und das „Leben“ im Sprachgebrauch
Wittgenstein betont die Bedeutung des alltäglichen Gebrauchs von Wörtern und die Art und Weise, wie Sprache in konkreten Handlungen eingebunden ist. Die Bedeutung von Begriffen wie „Natur“ ist deshalb nicht durch eine abstrakte Definition zu erfassen, sondern durch die Vielzahl von konkreten Handlungen und Interaktionen, die wir mit der Welt haben. Insofern ist „Natur“ immer auch mit den Lebensformen der Menschen verknüpft, die durch ihre Sprache und ihr Handeln die Welt gestalten.
2. Die Jagd als ein Sprachspiel
Die Jagd kann im Wittgenstein'schen Sinne als ein „Sprachspiel“ verstanden werden, in dem verschiedene Handlungen und Bedeutungen miteinander verknüpft sind. Es handelt sich dabei um eine Aktivität, die nicht nur eine körperliche Handlung darstellt, sondern in einen sozialen, kulturellen und sprachlichen Kontext eingebunden ist. Der Akt der Jagd ist von Bedeutung und Sinn nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, der die sozialen Normen, die ethischen Vorstellungen und die sprachlichen Praktiken umfasst, die die Jagd definieren.
2.1 Die Jagd als eine kulturelle Praxis
In vielen Kulturen ist die Jagd nicht nur ein Mittel zur Nahrungsbeschaffung, sondern auch ein soziales und symbolisches Handeln, das mit bestimmten Ritualen, Normen und Bedeutungen verbunden ist. Die Bedeutung der Jagd hängt davon ab, wie die Menschen sie in ihrer Lebensform verstehen. In einigen Kulturen kann die Jagd als ein Akt des Überlebens, der Männlichkeit oder der spirituellen Erneuerung angesehen werden, in anderen Kulturen könnte sie ein sportlicher oder wirtschaftlicher Akt sein.
Für Wittgenstein bedeutet dies, dass die Jagd in verschiedenen Sprachspielen unterschiedliche Bedeutungen hat. Was eine Jagd für einen bestimmten Jäger bedeutet, ist nicht universell, sondern abhängig von der sozialen Praxis und der Sprache, in der der Akt eingebettet ist. Die Jagd als Sprachspiel ist daher keine universelle Aktivität, sondern eine von vielen möglichen Praktiken, die durch den spezifischen Gebrauch von Sprache und Handlung Bedeutung gewinnen.
2.2 Die Bedeutung des „Ziels“ der Jagd
In der Jagd gibt es auch die Vorstellung eines „Ziels“ – das Tier zu erlegen. Dies ist eine wichtige Komponente des Sprachspiels der Jagd, da es das Ziel und den Erfolg der Aktivität bestimmt. Wittgenstein würde jedoch argumentieren, dass das „Ziel“ der Jagd nicht einfach nur das Erlegen des Tieres ist, sondern dass es sich durch die Praxis selbst konstituiert. Das Ziel und die Bedeutung der Jagd sind durch den Kontext und das „Spiel“ der Jagd, das durch spezifische sprachliche und kulturelle Praktiken definiert wird, bestimmt.
Wittgenstein würde sagen, dass wir den Begriff „Jagd“ und die Bedeutung des Ziels nicht abstrakt definieren können, sondern nur verstehen können, indem wir uns die vielfältigen Weisen ansehen, in denen dieser Begriff in verschiedenen Praktiken verwendet wird. Die Bedeutung des Ziels der Jagd ist insofern nicht festgelegt, sondern ergibt sich aus der Art und Weise, wie die Jagd in einem bestimmten kulturellen Kontext und in der Sprache verstanden wird.
2.3 Die Jagd als ethisches und praktisches Sprachspiel
Die Jagd kann auch als ein ethisches Sprachspiel betrachtet werden, das bestimmte Fragen der Moral und Verantwortung aufwirft. In verschiedenen Sprachspielen der Jagd könnte das Erlegen eines Tieres als moralisch gerechtfertigt oder als grausam angesehen werden, abhängig von den Normen und Werten der jeweiligen Kultur. Für Wittgenstein ist die Bedeutung von „gut“ oder „schlecht“ in diesem Kontext nicht fest und universell, sondern sie ergibt sich aus den jeweiligen Praktiken, in denen die Jagd stattfindet.
Das ethische Sprachspiel der Jagd könnte sowohl die Verantwortung des Jägers als auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier betreffen. Wittgenstein würde sagen, dass wir verstehen können, was „gut“ oder „richtig“ in der Jagd ist, indem wir uns anschauen, wie in der jeweiligen Lebensform und in den damit verbundenen Sprachspielen diese Begriffe verwendet werden.
3. Fazit
Wittgensteins Naturbegriff ist nicht ein metaphysisches Konzept, sondern ein Begriff, der im Kontext von Sprache, Bedeutung und sozialen Praktiken verstanden wird. Die Natur ist für Wittgenstein das, was wir in verschiedenen Sprachspielen und Lebensformen als „Natur“ begreifen. Die Jagd kann als ein Beispiel für ein solches Sprachspiel betrachtet werden, in dem der Mensch in einer bestimmten Art und Weise mit der Natur interagiert und in dem die Bedeutung und das Ziel der Jagd durch die kulturellen und sprachlichen Praktiken der Gesellschaft bestimmt werden.
Die Jagd ist in Wittgensteins Philosophie ein Akt, dessen Bedeutung nicht abstrakt definiert werden kann, sondern sich aus den spezifischen sozialen Praktiken und dem Gebrauch der Sprache ergibt. Der Begriff „Jagd“ ist damit ein Produkt von kulturellen und sozialen Kontexten, die durch Sprache und Handeln die Welt strukturieren. Insofern kann die Jagd nicht als eine isolierte, objektive Handlung verstanden werden, sondern als ein tief in die sozialen Praktiken und Sprachspiele eingebundener Akt, dessen Bedeutung sich in der konkreten Anwendung manifestiert.