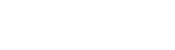Von Volker Seifert
Seit Jahrhunderten feiern wir Jäger am 3. November den heiligen Hubertus als unseren Patron. Hubertusmessen, Parforcehörner, feierliche Prozessionen – all das ist fest im jagdlichen Brauchtum verankert. Doch haben wir uns je gefragt, ob dieser „Jagdheilige“ überhaupt ein Jagdheiliger ist? Oder ob wir uns nicht vielleicht einen Heiligen zu eigen gemacht haben, der mit der Jagd eigentlich abgeschlossen hat?
Die Legende ist eindeutig: Hubertus jagte leidenschaftlich, ja maßlos, bis ihm an einem Karfreitag ein Hirsch erschien – mit einem Kreuz im Geweih. Dieses Erlebnis erschütterte ihn so sehr, dass er die Jagd aufgab, Buße tat und Bischof wurde. Mit anderen Worten: Hubertus wurde gerade dadurch heilig, dass er nicht mehr jagte. Seine Bekehrung war eine Abkehr von der Jagd, nicht ihre Weihe.
Und hier liegt die Provokation: Wenn wir uns Hubertus als Patron erwählen, feiern wir streng genommen keinen „Heiligen der Jäger“, sondern einen „Heiligen wider die Jagd“. Sein ganzes Leben nach der Vision war ein Bruch mit dem, was wir heute unter Weidwerk verstehen.
Theologisch betrachtet ist das Kreuz im Geweih kein Jagdsegen, sondern ein göttliches Stopp-Signal. Es war die Aufforderung, Maß zu halten, die Jagd zu verlassen und sein Leben Christus zuzuwenden. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir gestehen: Hubertus ist der Heilige der Bekehrung – nicht der Jagdleidenschaft.
Vielleicht liegt hier die eigentliche Herausforderung für uns Jäger: Hubertus ist kein romantisches Feigenblatt, das unser Tun segnet. Er ist vielmehr eine Mahnung, dass wir die Jagd niemals selbstzweckhaft oder hemmungslos betreiben dürfen. Wer Hubertus wirklich ernst nimmt, der darf die Jagd nicht verklären, sondern muss sie kritisch hinterfragen – und sich ihrer Grenzen bewusst bleiben.
Provokant gefragt: Vielleicht ist Hubertus als Patron gar nicht gewählt worden, weil er Jäger war, sondern gerade weil er keiner mehr sein wollte. Haben wir uns also den falschen Heiligen ausgesucht?
Der „Jagdheilige“ Hubertus – eine Legende im Widerspruch zu Natur und Theologie
Doch nicht nur theologisch, auch wildbiologisch wirkt die Hubertus-Legende widersprüchlich. Die Überlieferung spricht von einem prächtigen Hirsch mit ausladendem Geweih, in dem das Kreuz erstrahlte. Schauplatz: ein Karfreitag – also Frühjahr, rund um Ostern.
Nur: Jeder erfahrene Waidmann weiß, dass das Rotwild zu dieser Zeit sein Geweih längst abgeworfen hat oder erst im Bast ein neues schiebt. Ein kapitales, fertig ausgebildetes Geweih ist im Frühjahr schlicht nicht vorhanden. Ein Hirsch mit „voller Krone“ zu Ostern gehört ins Reich der Fabel, nicht in die Realität des Waldes.
Damit stellt sich die Frage: Wenn schon die zoologische Grundlage der Vision nicht trägt, warum hat sich gerade dieses Bild so tief in das jagdliche Brauchtum eingegraben? Vielleicht, weil es nicht um Jagd geht, sondern um Symbolik. Der Hirsch steht in der Bibel wie in der christlichen Ikonographie seit jeher für die Sehnsucht nach Gott, für Reinheit, für Christus selbst. Das Kreuz im Geweih ist weniger Jagdbild als Glaubensbild.
Was also bleibt? Ein Heiliger, der die Jagd aufgab, und eine Legende, die wildbiologisch nicht stimmen kann. Hubertus ist kein „Patron der Jagd“, sondern ein Symbol für Umkehr und Distanz zur Jagd. Wenn wir ihn trotzdem als Jagdheiligen feiern, dann bedienen wir eine Tradition, die mit der Wirklichkeit von Wild und Wald herzlich wenig zu tun hat.
Provokant gefragt: Vielleicht ist es Zeit, Hubertus von seinem Titel als Jagdheiliger zu entbinden?