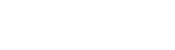Die Frühjahrsbejagung ist jagdpolitisch nicht zu rechtfertigen. Sie steht im Widerspruch zu den Grundsätzen eines verantwortungsvollen, tierschutzgerechten und ökologisch wirksamen Wildtiermanagements. Aus wildbiologischer Sicht befindet sich das Schalenwild im Frühjahr in einer Regenerationsphase nach dem Winter. In dieser Zeit sind die Energiereserven erschöpft, und das Wild ist darauf angewiesen, auf den ersten Grünflächen ungestört Nahrung aufzunehmen. Bejagung in dieser Phase führt zu einer massiven Beunruhigung: Das Wild meidet offene Flächen, verlagert seine Äsung in den Wald und verursacht dort zusätzliche Verbissschäden. Damit wirkt die Frühjahrsbejagung den forstlichen Zielsetzungen unmittelbar entgegen.
Zudem steht die Bejagung im Mai und Juni in direktem Konflikt mit dem Tierschutz. In dieser Zeit setzen Ricken und Alttiere ihre Jungen. Eine sichere Unterscheidung zwischen führenden und nichtführenden Stücken ist selbst für erfahrene Jägerinnen und Jäger schwierig und für Anfänger kaum zuverlässig möglich. Fehlabschüsse führen zu vermeidbarem Tierleid und untergraben die gesellschaftliche Akzeptanz der Jagd.
Vor diesem Hintergrund ist eine konsequente Konzentration der Jagdzeiten auf die zweite Jahreshälfte nicht nur fachlich geboten, sondern auch jagdpolitisch klug. Eine Jagdruhe von Januar bis einschließlich Juli trägt sowohl zur Entlastung der Waldökosysteme als auch zur Stärkung des Ansehens der Jagd in der Öffentlichkeit bei. Sie steht für eine moderne, verantwortungsvolle Jagdpolitik, die Wald, Wild und gesellschaftliche Erwartungen in Einklang bringt.