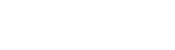Von Volker Seifert
Der Naturbegriff bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, ab 1808 Ritter von Schelling (* 27. Januar 1775 in Leonberg, Herzogtum Württemberg; † 20. August 1854 in Ragaz, Kanton St. Gallen), einem zentralen Vertreter der deutschen idealistischen Philosophie, ist ein faszinierendes Thema, das sowohl seine metaphysische Systematik als auch seine ästhetischen und ethischen Vorstellungen umfasst. Schelling sieht die Natur nicht als bloße, mechanische Ansammlung von Materie und Prozessen, sondern als lebendige, sich selbst organisierende Einheit, die im Einklang mit dem Göttlichen steht. Dieser Naturbegriff hat tiefgreifende Implikationen, die sich auch auf Bereiche wie die Jagd übertragen lassen, wenn man die Jagd als eine menschliche Aktivität betrachtet, die mit der Natur und ihrem „Wesen“ in Beziehung tritt.
1. Der Naturbegriff bei Schelling
Schelling unterscheidet sich in seinem Naturbegriff deutlich von der mechanistischen Auffassung der Natur, die vor allem im Rationalismus und in der aufkommenden Wissenschaft des 17. und 18. Jahrhunderts vorherrschte. Die Natur ist bei ihm keine bloße „Maschine“, sondern ein lebendiger Organismus, in dem sich das Absolute, das Göttliche, im Prozess der Entwicklung und Entfaltung zeigt. In seiner Philosophie des Naturbegriffs (insbesondere in seinem Werk „System des transzendentalen Idealismus“, 1800) argumentiert Schelling, dass die Natur nicht nur als äußere Erscheinung existiert, sondern dass sie die objektive Manifestation des Subjektiven, des Geistes, ist.
Die Natur ist in Schellings System kein passiver Gegenstand, der vom menschlichen Subjekt wahrgenommen wird, sondern sie ist immanent im Subjekt selbst. Das Subjekt und die Natur sind nicht zwei getrennte Sphären, sondern stehen in einem dynamischen, dialektischen Verhältnis zueinander. Das Subjekt erlangt sich selbst durch die Reflexion auf die Natur und erkennt seine eigene Freiheit und Kreativität in der Entwicklung der natürlichen Welt.
Ein entscheidender Aspekt des Schellingschen Naturbegriffs ist die Vorstellung, dass die Natur eine „lebendige“ Kraft besitzt, die sich selbst organisiert und entwickelt. Sie ist eine Art „Urstoff“, aus dem die Welt hervorgeht, und gleichzeitig der Prozess, durch den die Welt zu sich selbst gelangt. Die Natur ist also sowohl die Quelle als auch das Ziel des kreativen und schöpferischen Aktes, der sich in der Geschichte und in den natürlichen Prozessen manifestiert.
2. Die Anwendung des Naturbegriffs auf die Jagd
Die Jagd ist eine Aktivität, die auf den ersten Blick im Widerspruch zu den ethischen und ästhetischen Zielen stehen könnte, die Schelling mit seiner Philosophie verfolgt. Wenn man jedoch den Naturbegriff Schellings weiter verfolgt, lässt sich ein tieferes Verständnis für die Jagd als einen Akt gewinnen, der in einer gewissen Weise mit der natürlichen Ordnung und der Mensch-Natur-Beziehung verbunden ist.
2.1 Die Jagd als Teil der natürlichen Ordnung
Schelling sieht die Natur als eine Gesamtheit, in der alles miteinander verbunden ist. Die Jagd, als ein menschlicher Akt, der in die natürliche Welt eingreift, könnte man daher als ein Beispiel für das Wechselspiel zwischen Mensch und Natur verstehen. Wenn der Mensch jagt, tritt er in einen Dialog mit der Natur, wobei er sowohl von den natürlichen Gesetzen als auch von den eigenen ethischen und ästhetischen Vorstellungen beeinflusst wird.
In einem Schellingschen Sinne könnte die Jagd als ein Moment verstanden werden, in dem der Mensch die „lebendige“ Natur direkt erfahren und erleben kann. Hier manifestiert sich die Natur nicht nur als Objekt der Ausbeutung, sondern auch als Quelle von Erkenntnis und Spiritualität. Der Mensch wird sich durch den Jagdakt der natürlichen Welt bewusst, gleichzeitig erkennt er sich als Teil eines größeren, lebendigen Prozesses. Dabei könnte die Jagd nicht nur als eine körperliche Betätigung verstanden werden, sondern auch als eine Form der Selbstfindung und der „geistigen“ Beziehung zur Natur.
2.2 Die Jagd und das moralische Verhältnis zur Natur
Schelling war, wie viele Philosophen seiner Zeit, ein Verfechter einer ethischen Haltung gegenüber der Natur. In seiner Naturphilosophie steht die Freiheit des Menschen im Einklang mit der Natur, und diese Freiheit wird nicht als bloße Macht über die Natur verstanden, sondern als eine Verantwortung, sich im Einklang mit der natürlichen Ordnung zu bewegen. Dies könnte eine tiefergehende Bedeutung für die Jagd haben, die bei Schelling nicht als bloße Ausbeutung oder Zerstörung verstanden wird, sondern als ein Akt der Auseinandersetzung mit der Natur in einem ethischen Rahmen.
Die Jagd könnte als eine Form des Respekts gegenüber den natürlichen Lebenszyklen und der Lebenswelt der Tiere verstanden werden. In dieser Perspektive ist der Akt der Jagd kein willkürlicher oder grausamer Akt, sondern ein bewusstes Eingreifen in die natürliche Ordnung, das in einem ethischen und respektvollen Verhältnis zu ihr steht. Der Mensch ist in dieser Perspektive nicht ein Herrscher über die Natur, sondern ein Teil von ihr, der die Verantwortung trägt, mit ihr im Einklang zu handeln.
2.3 Die Jagd und die ästhetische Erfahrung
Schelling hebt in seiner Philosophie auch die Bedeutung der ästhetischen Erfahrung hervor, die er als eine Form der Erkenntnis des Göttlichen und des Absoluten versteht. In diesem Zusammenhang könnte die Jagd auch eine ästhetische Dimension haben, da sie den Jäger dazu anregen kann, die Schönheit und das Geheimnis der Natur zu erfahren. Die Jagd wird nicht nur als pragmatischer Akt des Überlebens oder der Nahrungsbeschaffung gesehen, sondern als ein Moment des tieferen Erlebens der Natur in ihrer vollen Komplexität und Schönheit.
Der Akt des Beobachtens, das Einfühlen in die Bewegungen der Tiere und das Erleben der Natur im Einklang mit den eigenen Instinkten könnte aus einer schellingschen Perspektive als eine Form der ästhetischen Kontemplation betrachtet werden. In diesem Sinne wird die Jagd nicht nur als ein ethischer oder biologischer Akt betrachtet, sondern auch als ein ästhetisches Ereignis, das den Jäger zur Erkenntnis einer tieferen Wahrheit über die Natur und sich selbst führen kann.
3. Fazit
Die Jagd, wenn sie aus der Perspektive von Schellings Naturbegriff betrachtet wird, kann als eine vielschichtige Aktivität verstanden werden, die sowohl ethische als auch ästhetische Dimensionen hat. Sie ist nicht bloß ein Akt der Zerstörung oder der Ausbeutung, sondern ein aktiver, bewusster Dialog mit der lebendigen Natur, der sowohl der Erkenntnis als auch der Verantwortung dient. In dieser Sichtweise tritt der Mensch in die Natur ein, nicht als ein Entfremdeter, der die Welt nur aus einer Distanz betrachtet, sondern als ein aktiver Teil des großen natürlichen Prozesses, in dem sich das Göttliche manifestiert.
Die Jagd kann als eine Form des Respekts und der Ästhetik verstanden werden, in der der Mensch seine eigene Freiheit und Verantwortung erkennt und gleichzeitig die Harmonie und das Geheimnis der Natur respektiert. Sie wird zu einer Möglichkeit, das Göttliche in der natürlichen Welt zu erfahren und sich selbst in dieser Erfahrung zu erkennen.