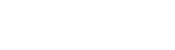Von Prof. Dr. Johannes Dieberger
In dieser neuen Serie wirft Univ.-Prof. Dr. Johannes Dieberger, BOKU Wien, einen geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung und den Werdegang der ältesten Jagdzeitung Österreichs - St. Hubertus.
Die Jagd vor hundert Jahren
Vor hundert Jahren war Österreich-Ungarn noch eine Monarchie und zusammen mit den restlichen Kronländern ein großer Machtkomplex. Drei unterschiedliche Sozialgruppen waren damals an der Jagd beteiligt. Die adligen Familien verfügten schon seit Jahrhunderten über Jagdrechte. Nach der Revolution von 1848 wurde mit dem Jagdpatent von 1849 das Jagdrecht auf fremden Grund und Boden aufgehoben, nur das Fischereirecht blieb ein eigenständiges Recht. Dadurch gingen dem Kaiserhaus die meisten Jagdreviere verloren. Man schuf daher für den jagdbegeisterten Franz Josef auf Staatsgründen sogenannte Leibgehege, in denen die Jagdausübung dem Kasiser vorbehalten war. In manchen angrenzenden Bereichen verzichteten die Eigentümer großer Eigenjagden aus Höflichkeit zu Gunsten des Kaisers auf ihr Jagdrecht, wodurch die Jagdmöglichkeiten der Leibgehege ausgeweitet wurden. Beides entsprach zwar nicht ganz dem Jagdrecht wurde aber durch "allerhöchste Entschließung" sanktioniert.
Die "Auch"-Jäger
Neben den Adligen konnten nun auch Bauern und Bürger an der Jagd teilnehmen. Dazu kamen noch - als dritte Gruppe - die Neureichen, die mit ihren Firmen oder Fabriken, durch Handel oder durch Bankgeschäfte vermögend geworden waren und daurch größere Jagdgebiete kaufen pachten konnten. Diese neuen Jagdherren versuchten an der Gesellschaft der alten Adelsfamilien teilzunehmen oder an einen Titel zu kommen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erfand man den Titel eines "Reichsritters", der an verdiente Staatsbeamte, Künstler, Wissenschaftler und Unternehmer vergeben wurde. Das verursachte dem Kaiser keine Kosten, aber den Betroffenen viel Freude. Der bekannte Jagdschriftsteller Raoul von Dombrowski, der unter anderem eine Monografie über das Rotwild, ein Lehr- und Handbuch für Berufsjäger verfasste und die achtbändige "Allgemeine Enzyklopädie der gesamten Jagd- und Forstwissenschaften" herausgab, nannte sich ab 1884 Raoul Ritter von Dombrowski. Das erinnert ein wenig an heutige Verhältnisse, wenn erfolgreiche Unternehmer mit etwas 50 Jahren noch zu Jungjäger werden und dann versuchen, Konsul eines Entwicklungslandes oder Doktor einer südamerikanischen Universität zu werden, weil ihnen der Titel Kommerzialrat zu bieder erscheint.
Strecke machen
 Die Jäger aus den alten Adelsfamilien bevorzugten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mehr die Gesellschaftsjagden und erfreuten sich an der Größe der erzielten Strecke. Es gab zu dieser zeit noch "Eingestellte Jagden", bei denen der Abschuß einer möglichst großen Schalenwildstrecke im Vordergrund stand. Ernst Ritter von Dombrowski beschreibt in seinem Buch über die Treibjagd, das 1904 herauskam, die Technik eines bestätigten Jagens bze. eines eingestellten Jagens, ähnlich wie dies im Barock schon üblich war. Dabei wurde das Wild aus einem größeren Teil des Jagdgebietes durch das Personal schon Tage vor der "Wildabschießung" vorsichtig in eine sogenannte Kammer zusammengetrieben. Am Jagdtag entließ man die Stücke gruppenweise in den sogenannten Lauf, wo sie von der vornehmen Jagdgesellschaft erlegt wurden.
Die Jäger aus den alten Adelsfamilien bevorzugten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts mehr die Gesellschaftsjagden und erfreuten sich an der Größe der erzielten Strecke. Es gab zu dieser zeit noch "Eingestellte Jagden", bei denen der Abschuß einer möglichst großen Schalenwildstrecke im Vordergrund stand. Ernst Ritter von Dombrowski beschreibt in seinem Buch über die Treibjagd, das 1904 herauskam, die Technik eines bestätigten Jagens bze. eines eingestellten Jagens, ähnlich wie dies im Barock schon üblich war. Dabei wurde das Wild aus einem größeren Teil des Jagdgebietes durch das Personal schon Tage vor der "Wildabschießung" vorsichtig in eine sogenannte Kammer zusammengetrieben. Am Jagdtag entließ man die Stücke gruppenweise in den sogenannten Lauf, wo sie von der vornehmen Jagdgesellschaft erlegt wurden.
(Bild rechts: Wilhelm Richter: Kaiser Franz Josef auf der Fuchsjagd)
Auch im Lainzer Tiergarten organisierte man noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts sogenannte "Sperrjagden" für die Angehörigen des Kaiserhauses und deren Gäste. Auch das waren eingestellte Jagden, bei denen Schwarzwild wie im Barock abgeschossen wurde. Dazu wurde das Gelände des Saulackenbodens benützt. Adolf Herzog, der Forstmeister des Tiergartens, hielt die Situation in einer Skizze aus dem Jahr 1905 fest. In jungen Jahren nahm auch Kaiser Franz Josef an solchen Veranstaltungen teil, später bevorzugte er die Einzeljagd auf Rotwild und Gams im Gebirge. Bis zum Ende des Kaiserreiches gab es in Österreich-Ungarn auch noch Parforce-Jagden. Dabei ging es jedoch nicht um größere Strecken, sondern nur um einen einzelnen Hirsch oder Fuchs. Das waren eher vornehme Reitveranstaltungen als Jagden. Kaiser Franz Josef liebte diese gar nicht, musste aber auch gesellschaftlichen Rücksichten öfters daran teilnehmen.
Aas- und Sonntagsjäger
 Bürger und Bauern schätzten mehr die Einzeljagd und waren mit einem erbeuteten Balg oder mit dem Wildbret von Rehwild, Hasen und dergleichen zufrieden. Solche Weidmänner wurden von neureichen Jagdherren und von Jagdschriftstellern oft als Aasjäger bezeichnet, ein Ausdruck, der sonst für Jäger, die sich nicht weidgerecht verhielten, gebraucht wurde. Viele der kleinen Leute, die nun auch jagen durften, mussten die ganze Woche einschließlich Samstag arbeiten und konnten nur am Sonntag dem Weidwerk frönen. Die besser situierten Kollegen, aber auch die Berufsjäger, machten sich über die jagenden Arbeiter und Angestellten lustig und bezeichneten diese als "Sonntagsjäger".
Bürger und Bauern schätzten mehr die Einzeljagd und waren mit einem erbeuteten Balg oder mit dem Wildbret von Rehwild, Hasen und dergleichen zufrieden. Solche Weidmänner wurden von neureichen Jagdherren und von Jagdschriftstellern oft als Aasjäger bezeichnet, ein Ausdruck, der sonst für Jäger, die sich nicht weidgerecht verhielten, gebraucht wurde. Viele der kleinen Leute, die nun auch jagen durften, mussten die ganze Woche einschließlich Samstag arbeiten und konnten nur am Sonntag dem Weidwerk frönen. Die besser situierten Kollegen, aber auch die Berufsjäger, machten sich über die jagenden Arbeiter und Angestellten lustig und bezeichneten diese als "Sonntagsjäger".
(Bild rechts: Carl Spitzweg: Der Sonntagsjäger, um 1845)
Erstabdruck: St. Hubertus, 2/2002, S. 26ff.